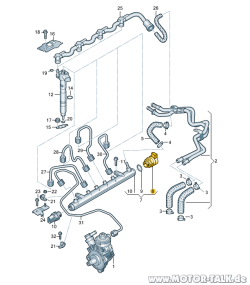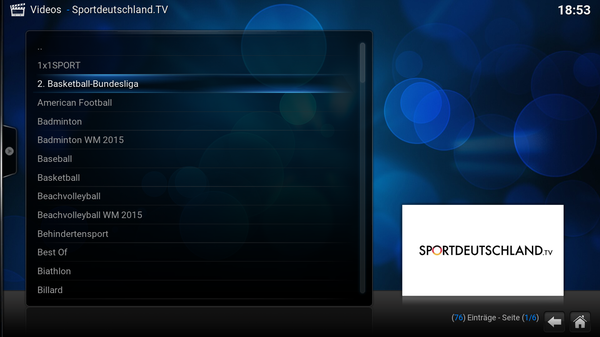Im Sinne einer umfassenden Prävention ist es an der Zeit, dass Lehrpersonen auch kompetent auf Gefahren aufmerksam machen, die Social Media-Aktivitäten mit sich bringen. Dabei sind zwei Punkte meiner Meinung nach entscheidend:
- Prävention sollte zum Ziel haben, dass Jugendliche eine Distanz einnehmen können und »nein« sagen können.
Es kann nicht das Ziel sein, ihnen ein schlechtes Gefühl zu geben, wenn sie auf dem Internet sozial aktiv sind oder sie zur Abstinenz zu erziehen, sondern sie kompetent und risikobewusst werden zu lassen. - Prävention erfordert von einer Lehrperson keine Detailkenntnisse in Facebook, Twitter und beim Schreiben von Blogs – genau so wenig, wie eine Lehrperson Gelegenheitsraucher oder -raucherin sein muss, um Rauchprävention thematisieren zu können.
Im Folgenden präsentiere ich eine fokussierte Zusammenfassung der Risiken, die als Ausgangslage für entsprechende Unterrichtseinheiten dienen kann. Ich werde wichtige Punkte fortlaufend ergänzen und die Zusammenfassung präzisieren. Für Hinweise in den Kommentaren bin ich dankbar.
1. Wer liest, was ich schreibe?
Kommunikation im Internet kann privat, halb-öffentlich oder öffentlich sein. Problematisch ist die Verwischung dieser Bereiche, was an zwei Beispielen gezeigt werden kann:
- Wer sind Freunde von Freunden?
Viele auf Facebook geteilte Bilder oder Notizen können sich »Freunde von Freunden« ansehen. Wer ist das?
Angenommen, man hat 200 Freunde und alle dieser Freunde haben wieder 200. Dann heißt das, dass 200×200, also 40’000 Menschen lesen können, was ich schreibe (etwas weniger, wenn mal alle mehrfach vorkommenden abzieht). Konkret aber: Die ganze Schule, der ganze Verein, das ganze Dorf.
Man sagt, alle Menschen auf der Welt kennen sich über fünf Stationen (»Kleine-Welt-Phänomen«) – was umgekehrt heißt, dass sich über zwei Stationen schon viel mehr Menschen kennen, als man denken würde. »Freunde von Freunden« ist kaum zu unterscheiden von »alle«. - Was kann mit privaten Chats geschehen?
Was in einem Chat geschrieben wird, ist auf einem anderen Computer abrufbar. Es kann kopiert werden – und dann veröffentlicht. Wenn man der besten Freundin heute schreibt, was man über Charlotte wirklich denkt – wie weiß man dann, dass Charlotte in einem Monat oder einem Jahr nicht eine Kopie von dem erhält, was man heute geschrieben hat?
Grundsätzlich wird alles, was ich in privaten Konversationen schreibe, für immer so gespeichert, dass es öffentlich werden kann.
2. Wer bin ich im Internet – und wer sind die anderen?
Oft verwendet man Pseudonyme im Internet – ich schreibe nicht unter meinem richtigen Namen, sondern als »D0nald$12«. Dennoch kann leicht herausgefunden werden, wer man ist:
- Man hinterlässt mit seinem Computer und Internetanschluss Spuren, die zwar nicht direkt sichtbar sind, aber entschlüsselt werden können.
- Man hinterlässt an verschiedenen Orten viele Informationen, die zusammen viel über einen verraten.
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass man mit einem Pseudonym nicht besser geschützt ist als ohne.
Gleichzeitig weiß man aber nie, wer andere sind. Auch Profile, mit denen man ganz lange gechattet hat, denen man vertraut – sind nur Profile. Dahinter stecken Menschen, die vielleicht ganz andere Absichten haben, die einen täuschen können. Man soll nicht allen Menschen, mit denen man im Internet kommuniziert, pauschal böse Absichten unterstellen – ihnen aber nur so weit vertrauen, wie man keinen großen Schaden erleiden kann: Das gilt besonders für Bereiche, in denen sich die virtuelle Realität mit der gelebten überschneiden (also Treffen, Bankkonten etc.).
Hier kann man sich die Anekdote in Erinnerung rufen, wie sich zwei Menschen in einem Forum ineinander verliebt haben. Das Problem der einen Person war nun, dass sie sich als »normalgewichtig« bezeichnet hatte, obwohl sie übergewichtig war. Deshalb zögerte sie ein Treffen hinaus – um dann schließlich herauszufinden, dass die andere Person genau dasselbe getan hatte. Moral: Genau so, wie ich mich selber nicht als mich selbst darstelle, tun das auch andere nicht im Internet.
3. Wie viel Information ist zu viel Information?
Menschen haben das Recht auf eine Privatsphäre: Ich muss meine Geheimnisse, Gedanken, Daten etc. niemandem verraten, wenn ich das nicht will. Diese Privatsphäre ist wichtig – nicht nur für mich, sondern auch für andere.
Wenn ich also etwas ins Internet schreibe, dann kann ich zwar Persönliches von mir preisgeben, wenn ich das möchte. Aber sobald ich Informationen über meine Freunde, meine Familie etc. veröffentliche, verletze ich damit ihr Recht, darüber zu bestimmen, wer was weiß.
Wichtig ist, dass mir gerade im Zusammenhang mit 1. folgender Grundsatz präsent ist: »Alles, was ich ins Internet schreibe, wird für immer gespeichert und kann möglicherweise von allen gelesen werden.« Gerade abschätzige Kommentare über Mitmenschen, Schulen und Organisationen kann einem später zum Verhängnis werden, auch wenn man selbst längst vergesssen hat, dass man das je gesagt oder geschrieben hat.
Zudem nutzen auch kriminelle Menschen das Internet. Macht man es ihnen zu leicht, herauszufinden, wer wann in den Ferien ist und den Hausschlüssel im Blumentopf versteckt hat, muss man sich nicht wundern, wenn der Goldschmuck nicht mehr da ist, wenn man aus den Ferien zurückkommt.
Wichtig ist also, gut zu überlegen, welche Information man warum veröffentlicht. Viele Informationen können auch kombiniert werden, ohne dass wir daran gedacht hätten. (Was wir vor drei Jahren auf Facebook veröffentlicht haben, ist immer noch dort…)
4. Passwörter sind kein sinnvoller Vertrauensbeweis
Junge Menschen tauschen Passwörter, um sich gegenseitig ihrer Liebe zu versichern oder ihr Vertrauen zu demonstrieren (hier ein guter Artikel aus der New York Times). Dieses Vorgehen ist gefährlich: Freundschaften zerbrechen, Vertrauen wird missbraucht.
Passwörter sollten persönlich sein. Wer aufgefordert wird, sein Vertrauen zu beweisen, sollte entgegnen, dass Vertrauen gerade nicht bewiesen werden kann oder muss. Vertrauen ist nicht Kontrolle.
Generell sollten Passwörter nicht leicht zu merken sein und regelmässig geändert werden, dafür gibt es einfache Tools, die hilfreich sind, z.B. OnePassword.
5. Privatsphäreneinstellungen und Konten löschen – hilft das?
Es gibt keine Social Media-Plattform, bei der es möglich ist, die Privatsphäre klar zu schützen und mit einer Löschung des Kontos sämtliche Informationen aus dem Internet zu entfernen. Diese Aussage ist wohl leicht übertrieben, aber ein hilfreicher Leitgedanke.
Das heißt nicht, dass man nicht bei jedem Netzwerk sich darüber im Klaren sein soll, wo Privatsphäreneinstellungen vorgenommen werden können und wie ein Konto gelöscht werden kann. Aber darauf zu vertrauen, ist gefährlich.
6. Mein soziales Umfeld im Internet
Jeder erwachsene Mensch kann nur 150 soziale Beziehungen unterhalten. Ob ich diese Beziehungen nun im Internet unterhalte oder nicht, ändert an dieser Tatsache nichts.
Virtuelle Beziehungen haben andere Eigenschaften als reale. Darüber sollte man nachdenken. Man exponiert sich im Internet auch, wird leichter angreifbar: Es ist leicht, einen gehässigen Kommentar zu schreiben, viel leichter, als eine Person direkt zu beleidigen. Ist man in Social Media aktiv, setzt man sich der Gefahr aus, beleidigt, bedroht, belästigt zu werden. Wenn das passiert, muss man sich an jemanden wenden, das mitteilen und sich wehren.
7. Sucht und Digitale Einsamkeit
Zuletzt kommen wir zu den psychischen Gefahren, die Social Media mit sich bringen. Es ist klar: Nicht jede Nutzerin von Facebook und jeder Nutzer von Twitter ist abhängig und erfährt psychische Probleme. Es handelt sich um Werkzeuge, die sinnvoll eingesetzt werden können. Sie bringen aber auch eine Gefahr mit sich, andere, wichtige Dinge zu ersetzen, zu verunmöglichen. Sie können uns einsam machen – und abhängig.
Der Kulturkritiker William Deresiewicz beschrieb 2010 im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, wie uns Social Media einsam machen:
[Die] Moderne [ist] von der Angst des Einzelnen geprägt, nur eine einzige Sekunde von der Herde getrennt zu sein. […] Ich möchte eine Analogie ziehen: Das Fernsehen war eigentlich dazu gedacht, Langeweile zu vertreiben – in der Realität hat es sie verstärkt. Genauso verhält es sich mit dem Internet. Es verstärkt die Einsamkeit. Je mehr uns eine Technik die Möglichkeit gibt, eine Angst des modernen Lebens zu bekämpfen, umso schlimmer wird diese Angst bei uns werden. Weil wir ständig mit Menschen in Kontakt treten können, fürchten wir uns umso mehr, allein mit uns und unseren Gedanken zu sein.
Für die Abhängigkeit gilt das, was für alle Suchtmittel gilt: So lange ich etwas genießen kann, darf ich das auch. Sobald ich es aber genießen muss, genieße ich es nicht mehr – und bin abhängig. Diesen Übergang gilt es zu vermeiden.
[Für Eltern und Lehrpersonen empfiehlt sich eine Lektüre des Leitfadens des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) als pdf.)